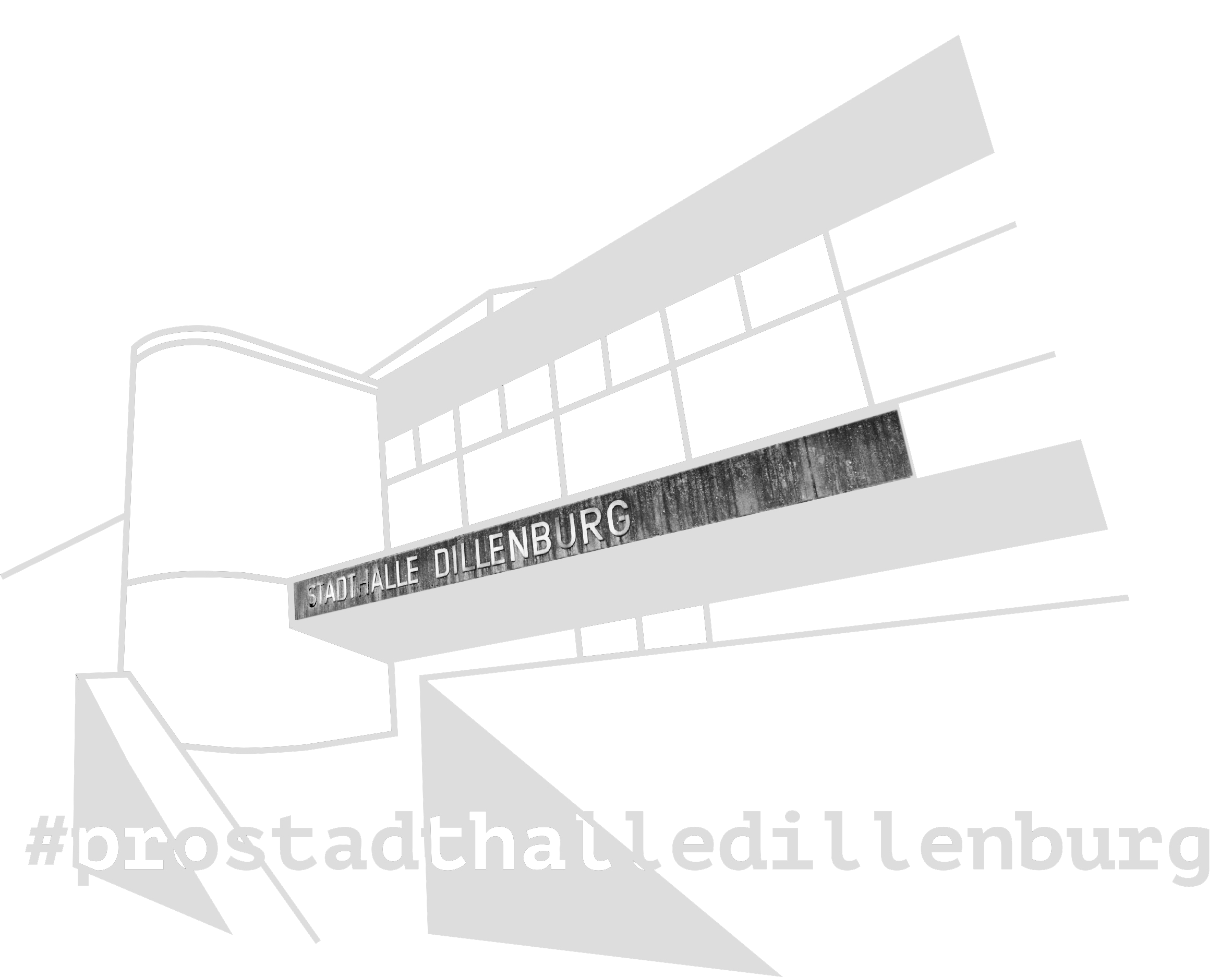Kleine Führung durch ein ungewöhnliches Bauwerk mit Charakter
Von Kilian Scharf und Wolfgang Schäfer
Die Entscheidung für den Bau der Dillenburger Stadthalle war gefallen. Einer der nächsten Schritte: ein hessenweit ausgeschriebener Architektenwettbewerb für das Gebäude. Fristgerecht hatten neun Bewerber ihre Arbeiten und Unterlagen eingereicht, vier Bewerber schieden bereits im Vorfeld aus. Die Arbeiten derjenigen, die in die engere Auswahl kamen, wurden anonym unter Angabe einer „Tarnzahl“ einer neunköpfigen Jury vorgestellt. Das Preisgericht trat am 17. Juli 1969 zusammen und wählte schließlich den Vorschlag Nr. 2929 aus: die Arbeit des Architekten Rainer Schell aus Wiesbaden.
Er plante ein dreigeschossiges Gebäude, das sich in das ansteigende Gelände vor dem Weinberg einfügt – ohne sich zu verstecken. Zur Geltung kommt daher ein als Rechteck erstellter Bau, geprägt durch den erhöht aufgesetzten Saalbereich, die halbrunden Sichtbetontreppenhäuser sowie die horizontalen Sichtbeton-Vordächer im Untergeschoss zur Talseite. Ins Auge fällt die horizontale Gliederung mit unterschiedlichen Fassaden von Untergeschoss und Erdgeschoss: Sichtbeton im unteren Bereich und dann folgt auf der darüber liegenden Ebene eine anthrazitfarbene kleinformatige Fassadenverkleidung. Optisch trägt das wesentlich zur unterschiedlichen Betonung der Geschosse bei.
Wie in einem kleinen Theater
Die auf das Gebäude abgestimmte Planung des Architekten lässt sich auch beim Betreten des Gebäudes erkennen. Schell nimmt den Besucher an die Hand – seine innere Wegführung gleicht einer „Inszenierung“, einem Schauspiel: vom Niedrigen ins Hohe, vom Dunkeln ins Helle. Der talseitige Haupteingang ist eher niedrig gehalten, ebenso Eingangsfoyer und Garderobe. Das Licht hier: eher spärlich.
Gleichzeitig sieht man schon den weiteren Verlauf über das Sichtbetontreppenhaus, das durch ein großes rundes Oberlicht hervorragend ausgeleuchtet wird.
Wer ins Treppenhaus kommt, erlebt die nächste Inszenierung. Schon auf den Treppenstufen lässt ich das lichtdurchflutete hohe Foyer im Erdgeschoss erkennen. Die gesamte Südseite ist mit großen Fenstern ausgeführt. Bewusst wird die großartige Aussicht auf die Altstadt und den Schlossberg vom Architekten in Szene gesetzt.
Rainer Schell hat bewusst mit unterschiedlichen Raumhöhen und Tageslichteinstrahlungen gespielt.
Der große „Oraniersaal“ ist ohne direkte ebenerdige Verglasungen ausgeführt und erhält sein Tageslicht ausschließlich durch Oberlichtbänder. Er gleicht eher einem kleinen Theaterraum, die Empore verstärkt diesen Gestaltungsansatz noch einmal.
Im Gegensatz dazu ist der anschließende kleine „Nassausaal“, der über die gesamte Länge mit einer mobilen Schiebewand zum großen Saal zu öffnen ist, mit einer großflächigen ebenerdigen Verglasung ausgeführt. Hinzu kommt noch der kleinere Charlotte-Petersen-Saal, im Paket unterstreichen die Räume eine äußerst vielfältige Nutzung.
So wie das Gebäude außen mit robusten, natürlichen Materialien ausgeführt ist, so wird dies auch in den Innenräumen weitergeführt. Alle Wandflächen in den Publikumsräumen bestehen aus unbehandeltem Sichtbeton. Alle abgehängten Decken sind Holzdecken, die Fußbodenbeläge bestehen entweder aus einem dunklen Parkett (beide Säle) oder aus rotfarbigen Tonfliesen. Außer den natürlichen Farbtönen der Oberflächen gibt es an künstlichen Farben nur die zahlreichen quadratischen Wandteppiche mit unterschiedlichen geometrischen Formen.
Bei Reden das gesprochene Wort bis in die letzte Reihe deutlich hören, bei Konzerten die Klangvielfalt genießen – diesen Spagat musste Rainer Schell bei der Akustik meistern. Umgesetzt wurden diese Vorgaben zusammen mit einem Raumakustiker, einem Fachingenieur.
Durch die Betonwände und den Parkettboden war dies keine einfache Aufgabe für das Duo. Den Löwenanteil, einen guten Klang zu erzeugen, trug die Holzdecke, ausgebildet als Akustikdecke. Die glatten Hölzer sind in einem genau festgelegten Abstand angeordnet. Darauf befindet sich ein schwarzes Akustikvlies mit aufgelegten Mineralfasermatten zur Reduzierung des Nachhalls. Hinzu kommen die Wandteppiche, vom Architekten Schell selbst entworfen, die ebenfalls dämpfend wirken.
Eine Besonderheit der Dillenburger Stadthalle ist die Ausführung der Bühne, die baurechtlich gesehen nur als „Szenenfläche“ angesehen wird. Ein Teil ist als absenkbare Hubbühne ausgeführt. So kann die bestehende Fläche bei Bedarf um 30 Quadratmeter vergrößert werden. Dieser Bereich der Bühne dient außerdem als absenkbarer Orchestergraben und als Transportaufzug für Stühle und Tische zum Stuhllager im Untergeschoss. Im Entwurf war zunächst ein Bühnenhaus vorgesehen, das fiel aber schließlich den Kosten zum Opfer.
50 Jahre Stadthalle Dillenburg
Der Grundstein wurde im Herbst 1972 gelegt, die Einweihung fand am 4. Oktober 1974 statt – in diesen Tagen feiert die Dillenburger Stadthalle Geburtstag. In den nächsten Ausgaben des „Dillenburger Wochenblatt“ stellt die Redaktion den Architekten Rainer Schell und seine Vielseitigkeit vor. Weiterhin blättern wir im Gästebuch der Stadthalle. Die Büttenpapier-Seiten offenbaren: Viel Prominenz aus Politik, Kultur, Sport und Showbusiness stand in Dillenburg auf der Bühne. (red)
Der „rohe“ Beton
Der Architekt Rainer Schell war ein Vertreter der Architektur des „Brutalismus“, einem Baustil der Moderne. Mit Gewalt oder Brutalität hat der Begriff in diesem Fall nichts zu tun – er kommt aus dem Französischen: „Béton brut“ bedeutet „roher Beton“. Mitgeprägt hat den Ausdruck der Schweizer Architekt Le Corbusier (1887–1965). Er begann nach dem Zweiten Weltkrieg damit, Beton so sichtbar zu machen, wie er sich nach dem Entfernen der Holzschalung präsentiert. Von daher der Name „Sichtbeton”.
Quellen: Tageszeitung, Der Standard, Wien, September 2024, Artikel: Architektur, Brutalismus: Deutschland entdeckt seine Betonmonster neu; Architekt Rainer Schell: „30 Jahre Architekt in Wiesbaden“ (Selbstverlag, 1980); Stadtarchiv Dillenburg: Ausgaben der „Dill Zeitung“: 1965, 1966, 1972, 1974; Unterlagen „Architektenwettbewerb Stadthalle Dillenburg“, Bauamt Oranienstadt Dillenburg; Der Baustil der Moderne, Wikipedia.